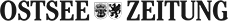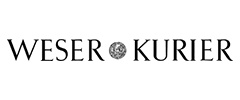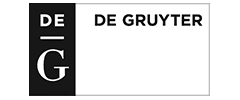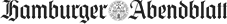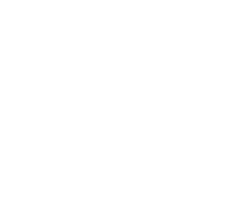Insbesondere in den Bereichen Prüfungsrecht, Studienplatzklage und der Verfassungsbeschwerde sind die Rechtsanwälte Dr. Heinze & Partner im Hinblick auf höchste Qualitätsmaßstäbe, die auf wissenschaftliche Publikationen in renommierten fachwissenschaftlichen Verlagen zurückzuführen sind, eine der schweizweit agierenden Kanzleien. Rechtsanwalt Dr. Arne-Patrik Heinze verknüpft jahrelange erfolgreiche praktische Erfahrung mit Lehre und Wissenschaft. Er vereint umfassende Publikationen mit bundesweiter Lehrerfahrung sowie Wirtschafts- und Verhandlungserfahrung als ehemaliger Geschäftsführer der BeckAkademie (Verlag C.H. Beck) und vertritt Sie vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), bei dem Dr. Heinze & Partner erfolgreich waren.
Die Rechtsanwälte Dr. Heinze & Partner sind eine kreative und progressive strategisch agierende Kanzlei, in der immer wieder neue Wege gegangen werden. Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im Team Dr. Heinze & Partner sind handverlesen sowie immer wieder Vorreiter und Ideengeber in ihrer sehr speziellen Branche. Durch die Größe des Anwaltsteams und dessen wissenschaftliche Publikationen wissenschaftlich anerkannten Verlagen sowie entsprechende Lebensläufe werden die notwendige Präsenz und Durchsetzungsfähigkeit der Rechtsanwälte Dr. Heinze & Partner gewährleistet. Einige Rechtsanwält*innen der Kanzlei Dr. Heinze & Partner waren selbst im staatlichen Sektor an Universitäten oder Hochschulen bzw. wirtschaftlichen Sektor tätig - z.B. der Gründungspartner Dr. Arne-Patrik Heinze, der Inhaber einer W2-Professur an einer Polizeiakademie sowie geschäftsführender Gründungsgesellschafter der BeckAkadmie (Verlag C.H. Beck) war. Vieles lässt sich nachahmen – Fachkompetenz nicht! Medienpräsenz und eine Gewinnermentalität sind den Rechtsanwälten Dr. Heinze & Partner wichtig. Medien bedeuten Kommunikation. Sie sind bei der Aufklärung ungerechter Ereignisse immer wieder hilfreich und können ein entscheidender Faktor sein, insbesondere, wenn Recht und Gerechtigkeit zu divergieren drohen.
Auch Fingerspitzengefühl und Verhandlungsgeschick spielen bei den Rechtsanwälten Dr. Heinze & Partner eine zentrale Rolle – aber erst, nachdem eine wissenschaftlich fundierte Verhandlungsposition aufgebaut wurde. Einen ordnungsgemäßen Antrag bekommen die meisten Rechtsanwälte in der Regel gestaltet – aber in der Argumentation im Verfahren zeigt sich, ob Ihr Rechtsanwalt in der Lage ist, wissenschaftlich zu argumentieren. Aufgrund ihrer Reputation, die nicht lediglich auf Medienberichten und Internetaktivität, sondern insbesondere auf wissenschaftlich fundierten Fachpublikationen basiert, die auch von Gerichten bei ihren Entscheidungen berücksichtigt werden müssen, werden Dr. Heinze & Partner von diversen Kollegen, Ärzten, Professoren, Intellektuellen sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik empfohlen.
Wegen zunehmender Auffälligkeiten im Rahmen der Rezensionen bei Google sowie anderen Portalen im Internet, deren Anzahl oft in einem erstaunlichen Missverhältnis zur Größe einer Kanzlei steht, sei bemerkt, dass die die Rechtsanwälte Dr. Heinze & Partner keine Bewertungen kaufen und für gute Bewertungen auch keine Vergünstigungen geben, da dies rechtswidrig ist.